
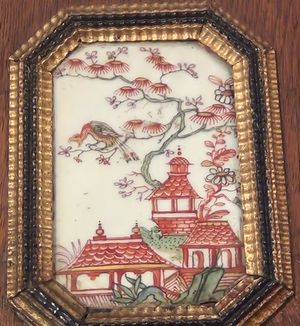



[Man sieht den Fernseher meiner Eltern. Im Fernseher sieht man das Schloß]
Der
Schrank kommt aus dem Schloß Schwadorf, welches mein
Urgroßvater 1926 erworben hat. Schwadorf liegt ca. 25 km von Wien entfernt, in der Nähe des Flughafens.
Dieses Datum, also das Jahr 1926 - und
eigentlich die ganze Familiengeschichte dieser Zeit - habe ich erst vor ein
paar Jahren entdeckt, als ich nach Wien gezogen bin. Ich wusste ja, dass die
Familie Segal bis 1938 in Wien lebte, aber mein Großvater hatte nie mit seinen
Kindern über diese Zeit gesprochen, geschweige denn mit seinen Enkelkindern.
Als ich an einem langen Abend Spuren über meine Familie im Internet suchte,
fand ich zuerst eine Liste mit herrenlosen Konten, neben einem Stand der Name
meines Urgroßvaters. Um Geld zu bekommen war es schon zu spät, aber es
brachte mich dazu, in das Staatsarchiv zu gehen.
[Man sieht mich vor dem Gebäude des Staatsarchivs]
Das Schloss ist nicht mehr im Besitz meiner Familie. 1938
wurde es arisiert. Mein Urgroßvater, damals 60, wurde im April 1938 von der
Gestapo verhaftet, als seine beiden ältesten Kindern in England waren. Er hat
sich vermutlich freigekauft und ist mit seiner Frau und meinem Großvater nach
Frankreich geflohen. Mein Großvater, damals 27, war von nun an das Oberhaupt
der Familie. Er hat seine Eltern versteckt und ist in die Fremdenlegion
eingetreten. So ist er Franzose geworden, und deshalb bin auch ich
Franzose ...
Juden mussten damals, in Wien, ihr ganzes
Hab und Gut deklarieren. Der nazistische bürokratische Apparat funktionierte so
gut, dass es heute möglich ist, das "Verzeichnis über das Vermögen von
Juden" wiederzufinden.
[Ich blättere durch das Verzeichnis von meinem Großvater]
Damit lässt sich die gesamte Geschichte des Schlosses rekonstruieren. Leider hatte 1927 das größte Erdbeben des 20. Jahrhunderts sein Epizentrum in Schwadorf. Das Schloss wurde stark beschädigt. Trotzdem konnte es meine Familie bis 1938 nutzen, auch wenn sie offiziell in der Reisnerstr. 27 im 3. Bezirk in Wien gemeldet war. Rasch nach dem „Anschluss“ wurden im Schloss Soldaten der Wehrmacht untergebracht. Ab 1945 wurde es unter der sowjetischen Besatzung schlecht verwaltet. Unabhängige Historiker haben bewiesen, dass es 1955, als es an meine Familie restituiert wurde, "extreme Ungerechtigkeiten" gab. Um das Schloß wieder zu bekommen, musste mein Großvater 500.000 Schilling zahlen. An eine Wiedergutmachung ist jedoch nicht zu denken. Jetzt kenne ich die Bedeutung von Vergangenheitsbewältigung ... und ihre Lücken. Es wurde in diesem Land so viel unter den Teppich gekehrt, dass man einerseits kaum darauf gehen kann, anderseits aber finde ich fast jeden Tag Inspiration, um über dieses Land zu schreiben. Mein Großvater wollte nichts mehr mit Österreich zu tun haben, hat nie ein einziges Wort auf Deutsch mit seinen vier Kindern gesprochen ... und verkaufte sofort das Schloss an die Familie Auer-Welsbach weiter [sie stehen im Adressbuch meiner Großtante Erna].. [Ich blättere Fotos]
 Mein
Großvater und mein Urgroßvater sind beide in Drohobycz geboren. Zu dieser Zeit
lag diese Stadt in der k.u.k.-Provinz Galizien, die heute zu einem Teil in
Polen und einem Teil in der Ukraine liegt. Früher war Drohobycz für mich nur
eine Stadt, deren Name schwierig zu merken war. Alle Mitglieder meiner Familie
waren Juden und am Ende des Ersten Weltkriegs, als die Kosaken kamen, mussten
sie wegen der Pogrome fliehen. Da sie geschäftlich schon mit einem Bein in Wien
standen, war es für sie naheliegend, dorthin zu ziehen.
Mein
Großvater und mein Urgroßvater sind beide in Drohobycz geboren. Zu dieser Zeit
lag diese Stadt in der k.u.k.-Provinz Galizien, die heute zu einem Teil in
Polen und einem Teil in der Ukraine liegt. Früher war Drohobycz für mich nur
eine Stadt, deren Name schwierig zu merken war. Alle Mitglieder meiner Familie
waren Juden und am Ende des Ersten Weltkriegs, als die Kosaken kamen, mussten
sie wegen der Pogrome fliehen. Da sie geschäftlich schon mit einem Bein in Wien
standen, war es für sie naheliegend, dorthin zu ziehen. 

Im
Staatsarchiv habe ich eine große Entdeckung über das Geschäft meiner Familie
gemacht. Sie waren im Erdölbereich tätig [beim Blättern
im Verzeichnis aus dem Archiv sieht man, dass mein
Urgroßvater Aktien in Erdölgesellschaften hatte].
Dieser Teil Galiziens wurde damals "Jewish Pennsylvania" genannt.
1909 war diese Region weltweit der drittgrößte Erdöllieferant. Niemand hatte
bisher in meiner Familie von Erdöl gehört.
Als "den ersten europäischen Ölrausch" hat man diese Periode
bezeichnet. Die Ölfelder lagen in Boryslaw und Schodnica; die Besitzer wohnten
in Drohobycz, welches ca. 8 km von Boryslaw entfernt ist.
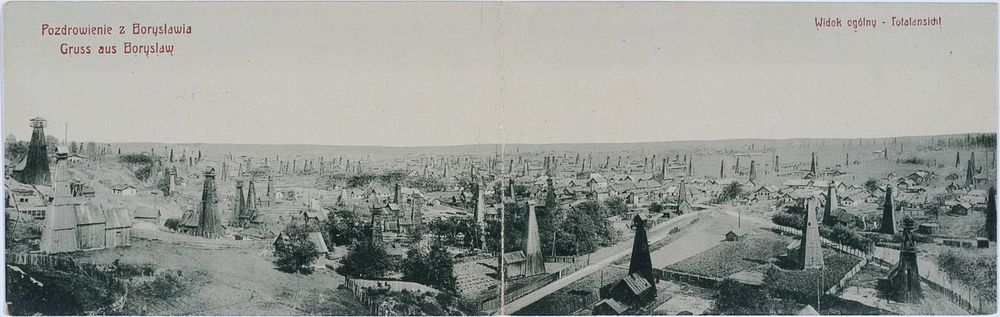 |
||
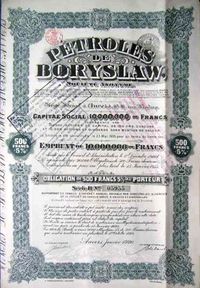 |
1880 besuchte Kaiser
Franz Josef die Ölfelder
|
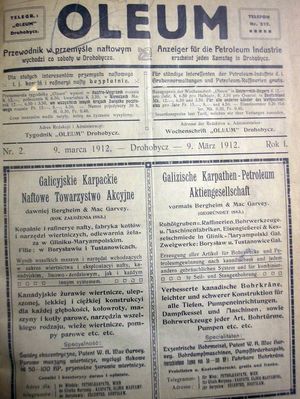 |

 Ich
habe mich gefragt, ob es nach dem Ersten Weltkrieg viele jüdische Familien gab,
die eine ähnliche Geschichte hatten. Ich habe mich vor allem gefragt, inwiefern
diese Erdölgeschichte das Schicksal der galizischen jüdischen Familie
beeinflusst hat. Meine Familie zum Beispiel hat, dank dem Erdöl, von einer
gewissen Mobilität profitiert. Nach dem Zerfall der Monarchie, 1918, waren die
Ölfelder in polnischen Händen. Mein Urgroßvater hat zuerst rumänisches
Erdöl in Wien verkauft, dann hat er in künstliche Seide investiert [man sieht Branchenbücher, wo
seine Name erwähnt ist]. Er wohnte in den noblen Bezirken von Wien
und hatte sein Büro in der Naglergasse, fast am Graben [man sieht diese beiden Häuser, wie sie heute sind].
Ich
habe mich gefragt, ob es nach dem Ersten Weltkrieg viele jüdische Familien gab,
die eine ähnliche Geschichte hatten. Ich habe mich vor allem gefragt, inwiefern
diese Erdölgeschichte das Schicksal der galizischen jüdischen Familie
beeinflusst hat. Meine Familie zum Beispiel hat, dank dem Erdöl, von einer
gewissen Mobilität profitiert. Nach dem Zerfall der Monarchie, 1918, waren die
Ölfelder in polnischen Händen. Mein Urgroßvater hat zuerst rumänisches
Erdöl in Wien verkauft, dann hat er in künstliche Seide investiert [man sieht Branchenbücher, wo
seine Name erwähnt ist]. Er wohnte in den noblen Bezirken von Wien
und hatte sein Büro in der Naglergasse, fast am Graben [man sieht diese beiden Häuser, wie sie heute sind].

[Gespräch mit Andreas Vormaier. Er hat eine Kopie aus den Staatsarchiven wo, in 1810, das galizische Erdöl für das erste Mal erwähnt wurde. Man sieht das Model einer Ölraffinerie, eine alte Karte wo die Besitzer aller Felder notiert sind. A. Vormaier erzählt von einem merkwürdigen Museum, in Boryslaw, ich will hinfahren...]
[Der Dekan behauptet, dass die Juden, erst
dann nach Drohobycz kamen, als sie erfuhren, dass dass es dort Erdöl gab. Ich
wiederspreche ihm: die Familie Backenroth, zum Beispiel, war seit dem 14. Jh in
Schodnica (ganz in der Nähe). Der Zuschauer bekommt den Eindruck, dass ich eine
Untersuchung mache. Wir fahren nach Boryslaw (10 km entfernt) und treffen dort
Oleg Mykulych, Leiter des Erdölmuseums.]
Allmählich verstehe ich, welche Rolle das galizische Erdöl gespielt hat, insbesondere für Juden wie zum Beispiel die Familien Erdheim oder Segal.
Manche sind am Ende des ersten Weltkriegs nach Wien geflohen, als die Kosaken Pogrome ausübten. So war es auch im Fall der Familie Segal, und auch bei einigen Brüdern der Erdheim Familie. Nach dem ersten Weltkrieg war es für viele Juden, anziehend wieder nach Drohocycz zurück zu kehren ... aber auch gefährlich, wie sie es ab 1939 am eigenen Leib erfuhren durften.
Die Mehrheit der Juden ist jedoch in Drohobycz geblieben. Unter ihnen finden wir auch Chaim/Imek Segal, der heute in Toronto lebt. Er hat 2012 ein reichlich illustriertes Buch veröffentlicht. Es heißt Chaim heißt Leben und berichtet über seine Zeit in Drohobycz und Boryslav. Heutzutage gibt es hier nur noch einen Juden aus der Vorkriegszeit, Alfred Schreyer, geboren 1922. [Ich unterhalte mich mit ihm und spaziere in seiner Umgebung.]
 |  Alfred Schreyer (1922 geb.) |  |
 |  |
 |  |
Unter
den Gedenktafeln bemerke ich einige Schriften auf Hebräisch. Es gibt
bestimmt Überlebende oder Nachkommen, die in Israel leben. Ich
entscheide mich, nach diesen Familien zu suchen. Dank Internet entdecke
ich einen Verein jüdischer Familien aus Drohobycz und Boryslav. Ich werde mich in Israel mit Nachkommenden der Familien Katz, Backenroth und Bronicky unterhalten.
Die Familie Backenroth ist eigentlich die bekannteste jüdische Familie aus der Gegend, mit einer Geschichte, die sich über 750 Jahren erstreckt. Sie hat eine entscheidende Rolle in der Erdölförderung gespielt.
Wir
treffen zuerst Lucien Bronicky, der heute immer noch im Energiebereich
tätig ist. Er erzählt uns seine Geschichte sowie die Geschichte seines
Vaters.
Frau Katz spricht dann das erste Mal ihres Lebens über die
Kriegsjahre. Wie sie überlebt hat und warum sie doch einen deutschen
Soldaten in guter Erinnerung hat.
| Jacob und Myriam Katz zu Hause |  Lucien Bronicki im Hauptquartier von Ormat, einer Firma, die von ihm gegründet wurde |
In Israel treffe ich auch
 Moshe Lubianeker (1930 geb.) |  Leszek Szefer (1913 geb.) |  Herr Igler (1924 geb.) |
 |  Sarah Preiss (geb. 1950) Sarahs Vather, Hermann Sekler, ist links und rechts auf ihre Privatarchiv Fotos | 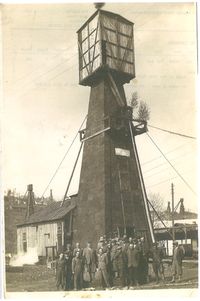 |